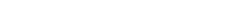Friederike Mayröcker: Ich bin in der Anstalt.
Fusznoten zu einem nichtgeschriebenen Werk. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2010. Geb.; 190 Seiten.
Rezension vom 25.05.2010 im literaturhaus.at
www.literaturhaus.at/index.php
Von doppelter Unendlichkeit usw.
Vom Grab ist sie nur noch einen Stolperstein entfernt. Einmal fällt sie spektakulär auf den Grabhügel direkt neben der frisch ausgehobenen Grube des gerade verstorbenen Wendelin Schmidt-Dengler. Ein andermal gerät sie an den Gräbern der Mutter oder ihres Lebensmenschen Ernst Jandl ins Straucheln. Das Leben der Hauptfigur von Mayröckers jüngstem Prosawerk "ich bin in der Anstalt" ist nur noch ein einziges Taumeln und Ausgleiten. Nach einer Lesung stolpert sie vom Podest. Die Überquerung der Straße zum Konsum wird zum unüberwindbaren Hindernis. Bei einem Schwächeanfall auf offener Straße sackt sie an einer Hauswand herab und landet, Aug in Auge mit einem Hund, auf dem Gehsteig. In ihrer Wohnung schafft sie es nur noch hinkend in die Küche und unsicher schwankend zum Abort und zurück ins Bett, wo sie sich von Tag zu Tag häufiger wiederfindet.
Die Bettstatt ist ihr zentraler Lebensmittelpunkt und Arbeitsplatz geworden. Hier schläft, liest und schreibt sie. Der ununterbrochene innere Monolog diffundiert in ihre Träume und Halbschlaf-Fantasien. Im Gegenzug träumt sie von Worten und Formulierungen, die sie beim Aufwachen an Ort und Stelle niederschreibt. Träume und Erinnerungen – oft an die Kindheit oder Erlebnisse mit Ernst Jandl –, Lektüre und Geschriebenes wachsen so täglich dichter zusammen. Morgens wacht sie auf dem von Papierfetzen bedeckten Betttuch auf, oder sie findet dort einen grünen Filzstift, der dem Laken seine Spuren eingeschrieben hat.
Dieses reine Geistesleben allein im Denken und Schreiben wird durch die drastischen Beschreibungen des körperlichen Alterungsprozesses konterkariert und durch anarchisch eingestreute Blumenmotive und Naturfragmente poetisch torpediert. Einmal liegen von Freunden aus dem Urlaub mitgebrachte kretische Steine am Morgen im Bett auf ihrem Magen oder an ihren Füßen, verblühte Bougainvilla segeln vom Regal oder Papierfetzen bedecken wie Herbstlaub den Boden der Wohnung, deren Möbel und Dinge sie gleichsam immer enger zu umwuchern scheinen. Der natürliche Kreislauf von Werden und Vergehen, Tod und neuem Wachstum ist Drohung und Versprechen in einem. "Ich lebe 1 Pflanzenleben", "lebe vegetativ", heißt es im Text. Die Angst der Sprecherin vor dem Sterben ist übermächtig. "Du bist im Sinkflug", hört sie von ihrer Freundin Edith S. "Es wird eng", bestätigt ihr Arzt. Um so größer die allmorgendliche Euphorie beim Erwachen im verschwitzen Leintuch. Jeder neue Morgen wird als persönliche Auferstehung erlebt, das Öffnen des Fensters als private Morgenandacht gefeiert.
Die Angst vor dem Tod und der Wunsch weiterzuleben sind grenzenlos und unhintergehbar wie die Sehnsucht nach dem je noch "nichtgeschriebenen Werk". Sie sind Motor eines gewaltigen Sehnsuchts-Vakuums, aus dem die "Fusznoten" ihre enorme suggestive Kraft beziehen. Denn die doppelte Bewegung manifestiert sich in der Sprache, durch die und in der die Sprecherin weiterlebt. Die Sprache bewegt sich bei gleichzeitiger Reduktion und Explosion des Sprach-Materials in zwei Richtungen auseinander. Einerseits in die von der Sprecherin laufend beklagte wachsende Verarmung der eigenen Ausdrucksmöglichkeiten und des täglich schrumpfenden persönlichen Wortschatzes. Andererseits in die Tendenz zum Auswuchern ihrer synchronen Sprech-Denk-Litanei im dauernden Wiederholen und laufenden Variieren tausendundeiner alltäglicher Kleinigkeiten. Die Reduktion wird demonstrativ zur Schau gestellt durch fehlende konstituive Satzteile und das häufige jähe Abbrechen der Sätze durch "etc" und "usw." Der Wildwuchs wird gestisch verstärkt durch den inflationären Gebrauch von mit "nämlich" eingeleiteten Selbst-Erläuterungen, Permutationen, opulenten Reihungen und der harten, absurd anmutenden Montage scheinbar nicht zusammengehöriger Themen- und Wortfelder. Dieser gleichzeitig systolische und diastolische Rhythmus ist das "Basso continuo", welches den Text zu seiner charakteristischen dramatischen Dynamik und mitreißenden Musikalität antreibt.
Die diametral entgegenlaufenden Bewegungen – die des Mangels und der Überfülle – sind ausgerichtet auf doppelte Unendlichkeit. Der Text weist in beide Richtungen systematisch über die Grenzen der Sprache hinaus – oft jenseits des rational Nachvollziehbaren. Die Autorin bekennt sich schon im Buchtitel zu diesem programmatischen Grenzgang. Mit ihrem Bekenntnis "ich bin in der Anstalt" stellt sie sich selbst als Dichterin und als Person radikal in Frage. Mit dem Wort "Bekenntnisse" beginnt ihr Text. Aurelius Augustinus wird von ihr mehrmals zitiert. In direktem Bezug auf seine "Confessiones" präsentiert sie ihr eigenes Buch als persönliches und literarisches Schuld- und gleichzeitiges Glaubensbekenntnis an die Poesie. Eine Konfession von beispielloser Schonungslosigkeit, Authentizität und poetischer Intensität, die kaum einen Leser unberührt lassen wird.